 Was viele ja noch gar nicht wussten: Statler und Waldorf kommen auch regelmäßig zu den Pöppelhelden. Natürlich können die beiden großen Grantler unter den Gamern nicht auf einem Balkon sitzen, weil sie sonst ja gar nicht an die Spielfiguren herankommen würden. Aber den Überblick haben sie trotzdem, und zwar sofort. Ihren kritischen Augen entgeht keine Schwäche. Nichts. Einfach sensationell. Neben den beiden grummeligen Grandseigneurs des Brettspiel-Begutachtungswesens war es im Spielesaal der Matthäus-Kirche mal wieder schön voll, 20 Spieler kamen und aßen Kuchen, tranken Malzbier. Ach ja: Und spielten, ganz viel, ganz Buntes, ganz Tolles. Nur eins nicht: Brügge. Das fehlte, Betrug, waren doch Statler und Waldorf eigens dafür gekommen.
Was viele ja noch gar nicht wussten: Statler und Waldorf kommen auch regelmäßig zu den Pöppelhelden. Natürlich können die beiden großen Grantler unter den Gamern nicht auf einem Balkon sitzen, weil sie sonst ja gar nicht an die Spielfiguren herankommen würden. Aber den Überblick haben sie trotzdem, und zwar sofort. Ihren kritischen Augen entgeht keine Schwäche. Nichts. Einfach sensationell. Neben den beiden grummeligen Grandseigneurs des Brettspiel-Begutachtungswesens war es im Spielesaal der Matthäus-Kirche mal wieder schön voll, 20 Spieler kamen und aßen Kuchen, tranken Malzbier. Ach ja: Und spielten, ganz viel, ganz Buntes, ganz Tolles. Nur eins nicht: Brügge. Das fehlte, Betrug, waren doch Statler und Waldorf eigens dafür gekommen.
Das macht die beiden natürlich etwas miesmutiger als sie es sonst eh schon sind, da sind sie gleich in der Laune, die sie sonst nur erreichen, wenn Fozzie-Bär auftritt. Um die Stimmung zum Sieden zu bringen, müsste jetzt natürlich Waka Waka gespielt werden. Haben wir aber auch nicht da.
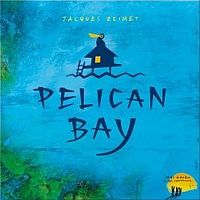 Stattdessen trifft es: Pelican Bay. Ganz frisch ist es auf dem Markt, herausgebracht hat das Spiel des Luxemburger Jacques „Die Kakerlake“ Zeimet der kleine Verlag Drei Hasen in der Abendsonne mit der so hübschen Internetadresse hasehasehase.de. Ein Familienspiel, dazu noch ein niedliches – und das jetzt am Tisch mit den grumpeligen Griesgramen, von denen nach einer Partie auch diese Szene überliefert wird: „Das Spiel hat mir gefallen“, kräht Statler. „Das sagt nichts“, bellt sein Nachbar, „dir hat auch der Zweite Weltkrieg gefallen.“ Ja, so sind sie.
Stattdessen trifft es: Pelican Bay. Ganz frisch ist es auf dem Markt, herausgebracht hat das Spiel des Luxemburger Jacques „Die Kakerlake“ Zeimet der kleine Verlag Drei Hasen in der Abendsonne mit der so hübschen Internetadresse hasehasehase.de. Ein Familienspiel, dazu noch ein niedliches – und das jetzt am Tisch mit den grumpeligen Griesgramen, von denen nach einer Partie auch diese Szene überliefert wird: „Das Spiel hat mir gefallen“, kräht Statler. „Das sagt nichts“, bellt sein Nachbar, „dir hat auch der Zweite Weltkrieg gefallen.“ Ja, so sind sie.
Wobei aus spielsoziologischer Sicht ja sogar zu beobachten ist, dass der Typus des spielenden Nörglers, der in Sekundenschnelle vernichtende Urteile fällen kann, mittlerweile weit verbreitet ist, es gibt gar eine ganze Schar den beiden Alten Folgender, alles Anhänger der Waldorf-Schule, sozusagen (nichts für ungut, Statler!). Möglich wurde die Verbreitung dieser Denkschule wahrscheinlich erst durch das Internet, wo sich regelrechte Gemeinden gebildet haben, die ihren größten Spaß daraus ziehen, über Spiele zu meckern. So gesehen, hat das Netz also auch Gutes: Früher wären die Menschen, die in erster Linie spielen, um anschließend über Spiele zu meckern, sehr verloren gewesen. Heute gehen sie nach einer Partie, die sie schlecht gelaunt zurückließ, einfach ins Spielbox- oder Unknowns-Forum, um sich über mangelnde Plättchen-Pappdicke, über zu simple oder auch gern mal über so verzwirbelte Spiele auszulassen. Früher wären sie mit ihrem Unmut allein gewesen, hätten die Enttäuschung in sich hineingefressen, bis es zu neurodermitischen Verwerfungen gekommen wäre. Heute können sie ihrem Hobby, Spiele nicht zu mögen, aber trotzdem ständig zu spielen, endlich in seelenhygienischer Gründlichkeit mit weltweiter Aufmerksamkeit nachgehen. Ist also nicht nur schlecht, dieses Internet.
Aber zurück zu Pelican Bay, dank Waldorf und Statler wird es übrigens tatsächlich das erwartete Schlachtfest, und bereits vor dem ersten Zug fällt das Urteil von Waldorf: Pelican Bay ist demnach ungefähr so unterhaltsam wie eine Fozzie-Bär-Nummer, keine Spannung – zu viel Glück – und überhaupt. Was aber passiert in der Pelikan-Bucht? Wir entdecken sie, Stück für Stück wuchert da der Urwald, dehnt sich der Strand aus und erschließt sich die Lagune neue Winkel unserer Bucht. Das Ungewöhnliche des Legespiels: Ein neues Hexplättchen darf nur platziert werden, wenn es an bereits zwei liegende andockt. Und wer seine beiden Plättchen auslegen will, der darf nur das gleiche Gebiet wachsen lassen. Zudem gibt es die Möglichkeit eines Doppelzuges, wenn ein Gebiet geschlossen werden kann, in das dann umgehend ein niedlicher blauer Pelikan fliegt und brütet.
Pelican Bay ist Urlaub für die Augen, so schön ist sie geworden. Lust auf eine Wiederholung macht das Spiel allein durch sein Aussehen. Nur: Das Spielgefühl passt so gar nicht zum Look. Da fühlt sich nichts organisch an, die Leichtigkeit der Optik findet sich nicht beim Plättchenlegen. Ganz im Gegenteil: Immer gibt es Nachfragen, wie man nun wo legen kann. Und wenn kein Gebiet geschlossen wird, dann gibt es jede Runde Punkte für einen immer größer werdenden Strand oder Wald oder Teich – was dann irgendwie in einer unerquicklichen Zählerei ausartet. Wir hätten das Spiel so gern gemocht, deswegen gab es auch eine Wiederholung in anderer Runde, aber so geht es nicht – zumal auch ein weiteres Regelstudium keinen Spielfehler ans Tageslicht förderte. Wie eine perfektbusige Granatenblondine, deren Attraktivität in dem Moment erlischt, in dem sie anfängt zu reden … Sieht also so aus, als wenn Waldorfs Vor-dem-ersten-Zug-Verriss auch noch stimmt. Ärgerlich, dass er Recht hat – schon aus Prinzip. Wobei das natürlich auch nur ein sehr persönlicher erster Eindruck nach zwei Partien in Vier-Personen-Vielspieler-Besetzung ist – und da kann ja so manches Spiel etwas zähflüssiger werden…
 Waldorf will nun Dortmund gucken. Brügge wollte er spielen, nix anderes. Und dann eben Fußball. Sein Abend droht ein Flop zu werden, weil in Spanien kein Tor fällt. So ein Mist. Im Matthäus-Tempel dagegen geht es auf die Jagd nach kostbaren Artefakten in Ägypten, auf Kreta, in Griechenland und Mesopotamien. Das bekommt dem einen oder anderen bekannt vor. Und genau: Jenseits von Theben ist das doch. Der Verlag, dessen Name nicht genannt werden darf, hat jetzt mit Die Grabräuber das Kartenspiel zum ehemaligen Spiel-des-Jahres-Nominierten herausgebracht.
Waldorf will nun Dortmund gucken. Brügge wollte er spielen, nix anderes. Und dann eben Fußball. Sein Abend droht ein Flop zu werden, weil in Spanien kein Tor fällt. So ein Mist. Im Matthäus-Tempel dagegen geht es auf die Jagd nach kostbaren Artefakten in Ägypten, auf Kreta, in Griechenland und Mesopotamien. Das bekommt dem einen oder anderen bekannt vor. Und genau: Jenseits von Theben ist das doch. Der Verlag, dessen Name nicht genannt werden darf, hat jetzt mit Die Grabräuber das Kartenspiel zum ehemaligen Spiel-des-Jahres-Nominierten herausgebracht.
Schon wieder ein Spin-Off. Tut das Not? Offensichtlich, sonst wäre das Spiel ja nicht erschienen. Aber im ersten Moment schießt einem doch böse kalauernd die melancholische, von Drafi Deutscher erdachte Melodie in den Sinn und man ertappt sich dabei, wie man leise summt: „Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind – dann sind wir jenseits von Theben …“ Andererseits: Gute Nummer eigentlich, haben damals ja auch die Ärzte gesungen, nicht nur Nino de Angelo. Um die Veröffentlichung des Karten-Ablegers des ehedem schon kartengetriebenen Brettspiels hat der Verlag, dessen Name nicht genannt werden darf, kein großes Getöse darum gemacht. Seit über einem Jahr wird das Erscheinen schon auf der Verlags-Homepage angekündigt – und jetzt es ist aufgetaucht, aus dem Nebel, ohne Fanfare und Tusch, einfach da. Und jetzt schon in Hundsmühlen. So kann es gehen.
Viele Karten liegen im Karton, über 160 kleine stapeln sich zum Talon, mit dem die Ausgrabungsstätten, die Nachzieh-Area, die Museen und Ausstellungen bestückt werden. Erhalten geblieben ist der schöne Zug-Zeit-Reihenfolge-Mechanismus, während das Chronokel zur simplen Tabelle geschrumpft ist, aber das ist verkraftbar. Die Spieler sind mal wieder als Archäologen unterwegs, büffeln in staubigen Bibliotheken, und wenn das Wissen groß genug ist, buddeln wir in staubigen Ausgrabungsstätten alter Kulturen. Während im großen Mutterspiel in wundervollen Beuteln in den Chips gewühlt wird, werden dieses Mal die Karten gemischt und entsprechend viele aufgedeckt. Ordentlich Schutt ist auch drin in dem Stapel, und da Statler mit großer Präzision den Schutt vom Stapel zieht, scheint es doch so etwas wie einen gerechten Spielegott zu geben. Hihi. Ist aber auch ein Glückspiel, deswegen fand der alte bärbeißige Gottvater der Blitzbrettspielkritik das Spiel schon in groß eher doofe.
Jenseits von Theben: Das Kartenspiel – Die Grabräuber -wie der schmissige, leicht zu merkende Kompletttitel lautet – ist natürlich auch vom Zugglück geprägt, aber das hat doch schon den Reiz des großen Spiels ausgemacht; Manchmal buddelt man eben im Dreck und findet einfach nichts. Archäologen-Schicksal. Peter Prinz ist es gelungen, das Brettspiel hervorragend in die kleine Schachtel herunterzubrechen. Wenn der Talon erstmal gemischt ist – wer das mit allen Karten kann, könnte seinen Lebensunterhalt auch mit Kartentricks verdienen –, spielt sich das Spiel locker und flott von der Hand. Das macht Spaß und sieht dabei übrigens auch noch verdammt gut aus. Wer Jenseits von Theben mochte, wird auch das nicht gerade günstige Kartenspiel mögen. Versprochen.
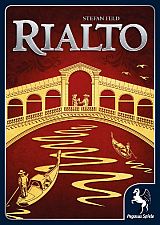 Zum Schluss mal wieder ein bisschen Feld-Forschung. Bora Bora haben wir ja schon gespielt, dieses türkise Meisterwerk der kapilaren Verschnörkelungen. Brügge musste am Mittwoch ja leider ausfallen, aber wir haben ja noch Rialto da, denn Meisterspieler Bodo nutzt den Abend als Trainingslager. Und während im Camp Kniffel gekartet wird, schnappen wir uns das Rialto. Also: Das sieht jetzt schon mal nicht so toll aus wie die anderen Frühlingsboten des Stefan Feld. Und es ist auch nicht so stark ineinander verwoben wie seine Geschwister, also am wenigsten wollknäuelig. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Man kann ja nicht immer nur diesen überbordenden Barock ertragen, mal darf es ja auch eine klare Linie sein, Neue Sachlichkeit, Bauhaus eben. Ebent!
Zum Schluss mal wieder ein bisschen Feld-Forschung. Bora Bora haben wir ja schon gespielt, dieses türkise Meisterwerk der kapilaren Verschnörkelungen. Brügge musste am Mittwoch ja leider ausfallen, aber wir haben ja noch Rialto da, denn Meisterspieler Bodo nutzt den Abend als Trainingslager. Und während im Camp Kniffel gekartet wird, schnappen wir uns das Rialto. Also: Das sieht jetzt schon mal nicht so toll aus wie die anderen Frühlingsboten des Stefan Feld. Und es ist auch nicht so stark ineinander verwoben wie seine Geschwister, also am wenigsten wollknäuelig. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Man kann ja nicht immer nur diesen überbordenden Barock ertragen, mal darf es ja auch eine klare Linie sein, Neue Sachlichkeit, Bauhaus eben. Ebent!
Und das ist Rialto: Ein schönes Mehrheitenspiel auf sechs Ebenen, angereichert mit ein paar Gebäude-Gadgets, die ein wenig Schwung in die Sache bringen. Mittels Auslage von sieben Karten, die jeder zu Spielbeginn auf der Hand hat, versuchen wir, uns die Mehrheiten zu sichern. Und der versierte Leser merkt schon, dass sieben Karten jetzt nicht übermäßig übertrieben viele sind, wenn sechs Mal geboten wird. Zumal wenn alles irgendwie wichtig ist. Zuerst wollen alle, um einen guten Blick auf das Geschehen im spielerisch schon arg gemolkenen Venedig zu erhaschen, mittels Mützengabe möglichst einen Dogenplatz ergattern, also Rang eins auf der Dogenleiste einnehmen und nienienie wieder hergeben. Aber natürlich ist es auch wichtig, Geld zu bekommen, um damit den Einsatz der Gebäude zahlen zu können. Ach ja: Gebäude bauen ist auch cool. Aber die Hoheit über Brücken, Gondeln und Ratsherrn ist jetzt auch nicht direkt unwichtig, denn das bringt über die Ratsherrenmehrheiten-Wertung (also eine Art der direkten Demokratie) die am Spielende so entscheidenden Siegpunkte. Man möchte also mal wieder alles tun – und kann so wenig. Und schon erinnert uns das Spiel wieder ans wahre Leben, hach.
Am Anfang einer Runde dürfen sich alle Venezianer eine von den ausliegenden sechs Karten umfassenden Reihen schnappen. Dann gibt es noch zwei Karten blind geschenkt. Und der richtige Stadtpalast erlaubt weiteres Nachziehen und eventuell sogar eine Kartenhand, die größer als die schäbigen sieben Karten sind. Dann wird auch schon geboten, wobei jede Mehrheit mit einem kleinem Bonus versüßt wird, der sich schon ziemlich lohnt. Das wird in sechs Stadtteilen durchexerziert, ist im Grunde hochtheoretisch und rein mechanisch und so überhaupt nicht irgendwie thematisch (das alte Feld-Paradox: suboptimale Themeneinbettung, trotzdem grandioser Spielspaß), ist aber sehr gelungen und faszinierend. Wir halten also fest: Bora Bora gut, Brügge gut (dazu an dieser Stelle bestimmt ein anderes Mal mehr), Rialto gut. Da kann man nur sagen: Danke Stefan Feld, danke den drei Verlagen für so gute Arbeit. Und wir freuen uns schon auf den Herbst, wenn es die Waldorf-Schüler sicherlich zerreißt, denn da erscheint der nächste große Feld, und zwar bei dem Verlag, dessen Name nicht genannt werden darf.
Außerdem wurden dieses Mal gespielt: Augustus, Dungeon Fighter, Ginkgopolis, Kniffel – Das Kartenspiel, Qwixx, Smash Up!, Ubongo 3D





Neueste Kommentare